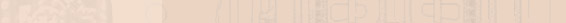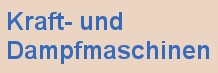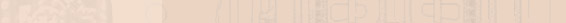| Zeit |
Ereignis |
| 1626 |
Zwei Junker aus Dörrebach beschweren sich bei dem Erzbischof von Mainz, daĂ bei der benachbarten Stromberger NeuhĂŒtte (in der NĂ€he des FĂŒllenbacher Hofes) zusammen mit spanischen und französischen Soldaten,bei der Erzsuche Flur und HolzschĂ€den entstanden seien. In unmittelbarer Nachbarschaft dieses Hofes liegt spĂ€ter die jahrelang betriebene Manganerzgrube "Concordia" |
| 1800 |
Die Grube "Concordia" wird um 1800 im Tagebau, mit zeitweilig 90 Mann betrieben und zwar von den GebrĂŒdern Wandesleben aus Stromberg. Erzaufbereitung mit Waschtrommeln und Setzmaschinen, betrieben mit Wasserkraft auf der Stromberger NeuhĂŒtte. |
| 1832 |
Behördliche Konzession an die Betreiber der Grube Concordia, Gebr. Sahler (Besitzer der Stromberger NeuhĂŒtte). |
| 08.10.1839 |
Behördliche, Konzession an die Gebr. Sahler auf Grund von Manganerzfunden in BingerbrĂŒck "Elisenhöhe", GröĂe der Konzession 2.415.800 m2. |
| 1840 |
Im Förderregister der Firma Wandesleben steht fĂŒr die Förderung auf der "Concordia" 35 Tonnen Manganerze. |
| 1845 |
Erste planmĂ€Ăige bergmĂ€nnische Gewinnung der Erze auf der Elisenhöhe' (Verkauf an die chemische Industrie zur Herstellung von Chlor und Sauerstoff). |
| 1847 |
Einstellung der Förderung |
| 1847 |
Der SaarbrĂŒcker Fabrikant Reppert erhĂ€lt die Konzession "Waldalgesheim" westlich vom Grubenfeld Elisenhöhe. GröĂe: 1.815.740 m2 |
| 12.12.1851 |
Nach dem Tod des Gewerken Jakob Sahler, lĂ€Ăt die Witwe auf Antrag durch MinistererlaĂ das Grubenfeld "Elisenhöhe" auf 3.467.800 qm erweitern. |
| 26.07.1867 |
Durch Heirat einer Tochter Sahlers mit dem Arzt Dr. Friedrich Wandesleben aus Stromberg kommen ie Konzessionen am 26. Juli 1867 von "Concordia" und "Elisenhöhe" in den Besitz der Gebr. Wandesleben. |
| 1882 |
Der Architekt Dr. Heinrich Claudius Geier aus Mainz beginnt mit SchĂŒrfversuchen bei den Ortschaften Seibersbach, Weiler und Waldalgesheim. |
| 1883 |
Die erfolgreichen Untersuchungsarbeiten Von Dr. H. C. Geier fĂŒhren in den folgenden Jahren zur Verleihung von 12 getrennten Grubenfeldern (Verleihung von Bergwerkseigentum) auf Eisen und Mangan. |
| 1885 |
Dr. Heinrich Claudius Geier beginnt im verliehenen Grubenfeld "Amalienshöhe" Bohrungen niederzubringen und SchĂ€chte abzuteufen. 18 Meter unterhalb der ErdoberflĂ€che stöĂt er auf das Manganerzlager, worauf ein erster 32 Meter tiefer Schacht abgeteuft wird. |
| 1887 |
Abbau im Pfeilerbau von unten nach oben mit Versatz. |
| 1887 |
Die Gebr. Wandesleben fĂŒhren am BingerbrĂŒcker Kalksteinbruch (spĂ€teres Hochhaus an der Stromberger StraĂe) ausfĂŒhrliche Untersuchungen des Erzvorkommens mit Hilfe von drei Stollen durch. (Nachdem 1847 und 1884 die Prospektionsarbeiten eingestellt wurden). |
| 1888 |
Bau der Grube Amalienshöhe und Abteufen des Schachtes. |
| 1891 |
Konzession des SaarbrĂŒcker Fabrikanten Reppert an die Gewerkschaft Waldalgesheim mit ihrem ReprĂ€sentanten Kommerzienrat Karl Spaeter aus Koblenz. Dieses Grubenfeld wird 1847 verliehen und ist westlich des Grubenfeldes Elisenhöhe. GröĂe: 1.815.740 qm. |
| 1893-1894 |
Die Grube "Concordia" erreicht im Zeitraum 1893/94 eine Jahresförderung von ĂŒber 7.000 Tonnen. |
| 1894 |
An der RheinuferstraĂe kurz hinter BingerbrĂŒck (spĂ€tere B 9) wird im Grubenfeld Elisenhöhe der 775 Meter lange "Bingerloch-Stollen" aufgefahren. Die Erzförderung geht direkt zur Eisenbahn. |
| 1898 |
Der "Hermann-Schacht" westlich von Weiler wird abgeteuft. |
| 22.01.1898 |
Dr. Heinrich Claudius Geier stirbt. Die BetriebsfĂŒhrung erfolgt sodann durch, seinen Sohn, Ernst Geier. Die Witwe Philippine Anna Jacobine Geier geb. Mayer, ist Mitbesitzerin. Die Grube wird umbenannt in: "Dr. Heinrich Claudius Geier Wwe., Waldalgesheim bei BingerbrĂŒck. |
| 1899 |
Erste BemĂŒhungen wegen einer gemeinsamen Wasserlösung der "Gebr. Wandesleben" und Dr. Geier" durch einen tiefen Stollen zum Rhein. Schwierigkeiten mit der Wasserhaltung und mit Schwemmsanden sind der Grund. |
| 06.11.1902 |
Die Witwe Dr. Geiers stirbt. |
| 1903 |
Die Firma Dr. Geier teuft an der Markscheide, östlich (heute Kunoweg - Richtung Weiler - heute Dittlofweier) einen 80 Meter tiefen SchĂŒrfschacht ab. Die MĂ€chtigkeit des Erzlagers ist lediglich 120 cm. |
| 1903 |
Die Fa. Gebr. Wandesleben teuft nach Westen vom Hermann-Schacht aus eine Richtstrecke (zum spÀteren Kunoweg). Diese finden reichlich Erze mit guter Beschaffenheit und MÀchtigkeiten von 3 m, 6 m und stellweise sogar von 12 m. Der Aufschluà beginnt. |
| 1904 |
Erstmalig wird der bis dahin noch nicht aufgeschlossene Dolomit auf der Grube "Amalienshöhe" angefahren. |
| 02.03.1904 |
Die Gebr. Wandesleben kaufen das Grubenfeld "Waldalgesheim" welches 1847 von Reppert aus SaarbrĂŒcken gekauft und 1891 an die Gewerkschaft Waldalgesheim verkauft wurde. GröĂe: 1.815.740 qm. Mit dem erweiterten Grubenfeld "Elisenhöhe" und dem neu erworbenen (3.467.800 qm) ist nun die GesamtgröĂe: 5.283.540 qm. |
| 25.11.1904 |
Der Familienbesitz von den Erben der Philippine Geier wird in eine tausendteilige "Gewerkschaft Braunsteinbergwerke Dr. Geier" eingebracht. Die Finanzlage der Dr. Geier-Erben ist vmtl. zu dieser Zeit sehr angespannt. |
| 25.03.1905 |
Die Gewerkenversammlung findet in Koblenz statt. Die Hauptgewerken (HaupaktionĂ€re) sind die "Metallgeselischaft", Deutsche Effekten und Wechselbank" und die "Metallurgische Gesellschaft". Die Kuxeninhaber (AktionĂ€re) beschlossen die GrĂŒndung einer neuen Gesellschaft mit dem Namen "Consolidierte Braunsteinbergwerke Dr. Geier". Die Grubenfelder "Amalienshöhe", "Philippine", "Clemens", "Hasenkopf', "BĂŒdesheimer Wald" und "MĂŒnster" werden konsolidiert (zusammengelegt). |
| 29.07.1905 |
Die am 25. MÀrz beschlossene Konsolidation vom Oberbergamt Bonn bestÀtigt. |
| 01.01.1909 |
Ăbernahme der Grubenleitung durch den Geologen Dr. Ernst Esch und der Aufschwung der Gruben beginnt. |
| 1909 |
Das reiche sogenannte "Glockenwiesen-Lager" wird entdeckt |
| 1910 |
Der Abbau des "Glockewiesen-Lagers beginnt. Es enthÀlt etwa 2 Millionen t Manganerz. |
| 09.03.1911 |
Nach wiederholten Verhandlungen kommt es zum Kauf des gesamten Grubenbesitzes der Gebr. Wandesleben GmbH, Stromberg durch die "Consoldierten BraunsteinbergWerke Dr. Geier". Damit befindet sich der gesamte Felderbesitz der erzfĂŒhrenden Zone in einer Hand. |
| 07.1911 |
Mitte des Jahres 1911 wird mit dem Bau der Seilbahn zum Rhein begonnen. |
| 1912 |
Bau eines Kraftwerkes zur Stromerzeugung zwischen den Gruben "Amalienshöhe" und "Elisenhöhe" mit der "Rhein-Nahe-Kraftversorgung AG", Bad Kreuznach. |
| 08.08.1912 |
Inbetriebnahme der Seilbahn. Die LĂ€nge ist 7.600 m und reicht bis zur Burg Sooneck, bei Trechtingshausen. |
| 1913 |
Ernst Geier scheidet aus der Firma aus und kauft sich eine Dachschiefergrube. Er fÀllt im Ersten Weltkrieg. |
| 1914 |
Erstmalige Jahresförderung der beiden Gruben ĂŒber 100.000 Tonnen. |
| 01.07.1914 |
Beginn der Auffahrung des Rheinstollens zur gemeinsamen Wasserlösung 1.200 m nordwestlich von BingerbrĂŒck. |
| 01.08.1914 |
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges SchlieĂung der Gruben. Allerdings können die Gruben im Oktober 1914 und im Laufe des Jahres wieder geöffnet werden. |
| 1916 |
Durch die Kriegsereignisse und die NichtverfĂŒgbaikeit von auslĂ€ndischen Erzen veranlaĂt die Heeresleitung den "Bingerlochstollen" wieder öffnen zu lassen. Die Belegschaft betrĂ€gt 467 Mann. |
| 1916 |
Im Schwarzkalkbruch in BingerbrĂŒck (spĂ€teres Hochhaus an der Stromberger StraĂe) wird der "untere" und der "obere" Geygerstollen aufgefahren. Benannt nach dem EigentĂŒmer Oberfinanzrat a.D. Geyger. |
| 10.1916 |
Im Oktober entschlieĂt sich die Grubenleitung, eine neue Hauptschachtanlage auf der Stöckerthöhe zu errichten. |
| FrĂŒhjahr 1917 |
Im FrĂŒhjahr 1917 ist der Beginn der Arbeiten an den Tagesanlagen der neuen "Amalienshöhe". Belegschaft: 1.018 Mann Förderung: Absolute Spitze in der Geschichte 280.853 Tonnen Manganerz. |
| 1917 |
Die Grube "Concordia" wird wieder geöffnet und mit einer neuen Bahnstrecke Langenlonsheim - Simmern angeschlossen. Insbesondere wegen des Phosphorit als kriegswichtiges Mineral, das im "liegenden" Manganerzvorkommen anzutreffen ist. |
| 1917 |
AufkÀufe von Kuxen an der Börse |
| FrĂŒhjahr 1918 |
Im FrĂŒhjahr 1918 sind die Tagesanlagen der neuen Hauptschachtanlage bereits schon im Rohbau fertig. |
| 01.01.1918 |
Anfang des Jahres 1918 verkauft die Firma ihre noch verbliebenen 673 Kuxen an die Mannesmann Röhrenwerke AG in DĂŒsseldorf. |
| 06.1918 |
Bei einer Gewerkenversammlung stellt sich heraus, daĂ 287 Kuxen im Besitz von der Friedrich Krupp AG, Essen und 40 Kuxen im Besitz von dem Baron de Curel aus Paris sind. |
| 1921 |
Max StrauĂ beschreibt in der "Neudeutschen Baukunst" ausfĂŒhrlich die neue Grubenanlage. |
| 1922 |
Die Arbeiten werden durch die Kriegs- und NachkriegsverhĂ€ltnisse stark eingeschrĂ€nkt und mĂŒssen mehrfach unterbrochen werden. |
| 1922-1923 |
Als Folge des passiven Widerstandes tritt 1922/23 ein RĂŒckgang der Erzabnahme ein. Die Arbeiten im "Bingedochstollen" und den beiden "Geygerstollen", welche groĂe Erzmengen freigaben, mĂŒssen aufgegeben werden. |
| 03.1922 |
Im MĂ€rz verstirbt der Bergwerksdirektor Kommerzienrat Dr. Ernst Esch, welcher mit Sicherheit auch die beiden DarmstĂ€dter Architekten Markwort und Seibert engagierte und die neue Anlage planen und bauen lieĂ. Max Blau wird neuer Direktor. |
| 1924 |
Durch die Kriegs- und NachkriegsverhĂ€ltnisse sind die Arbeiten im "Rheinstollen" stark in Verzug geraten und mĂŒssten sogar mehrmals unterbrochen werden. Erst ab 1924 können die Vortriebsarbeiten zum AbschluĂ gefĂŒhrt werden. |
| 1925 |
Der Straubenschacht wird im Jahre 1925 bis zur GrĂŒnsohle (211 m Teufe) niedergebracht. |
| 1926-1927 |
Durch ausreichende RĂŒckstellungen ist es 1926/27 möglich geworden, an der Börse die verbliebenen Anteile zurĂŒckzukaufen. |
| 1926-1927 |
Neubau einer Versuchsanlage mit Sinterpfannen, die von der Lurgi-Gesellschaft in Frankfurt am Main geliefert wird, um mit den russischen Erzen konkurrieren zu können. (1926/27) |
| 1928 |
Die Mannesmann Röhrenwerke AG, DĂŒsseldorf werden die AlleineigentĂŒmer - die Produktion geht auf jĂ€hrlich 78.000 Tonnen Manganerz zurĂŒck. |
| 27.07.1929 |
Der "Straubenschacht" wird bis zur Rheinsohle (267 m Teufe) niedergebracht. Hier erfolgt am 27. Juli 1929 der Durchschlag mit dem Rheinstollen, der fĂŒr die Zukunft der Betriebe von groĂer Bedeutung ist. |
| 01.09.1929 |
Im September 1929 liegen 30.000 Tonnen Erze auf Halde. Der gesamte Grubenbetrieb wird eingestellt. |
| 07.1933 |
Von September 1929 bis Juli 1933 ist das Bergwerk stillgelegt. |
| 1934 |
Die Schwierigkeiten sind ĂŒberwunden, die Förderung steigt wieder an. |
| 1936 |
Die Förderung erreicht wieder ĂŒber 100.000 Tonnen. |
| 01.01.1939 |
Die Betriebe in Waldalgesheim unterstehen der Bergbauabteilung in GieĂen der Mannesmann Röhrenwerke AG. |
| Beginn 2. Weltkrieg |
Nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges wird auf Anordnung des Amtes fĂŒr Roh- und Werkstoffe die Förderung stark forciert. Die Förderung erreicht jedoch nicht mehr die Höhe von 1917, da aus der Ukraine auch Mahganerze zur VerfĂŒgung stehen und die Gruben Luftangriffen ausgesetzt sind. |
| 1944 |
Höchste Fördermenge wÀhrend des zweiten Weltkrieges mit 159.514 Tonnen. |
| 15.03.1945 |
Alliierte Truppen besetzen die Grube und legen alle Betriebe still. Als TreuhÀnder wird Generaldirektor Max Pignon aus Paris eingesetzt. |
| 12.1945 |
Im Dezember kann mit Zustimmung der französischen Besatzungsbehörde die Förderung in geringem Umfang wieder aufgenommen werden. |
| 1948 |
Die Grube Elisenhöhe wird wieder in Betrieb genommen. |
| 1949 |
Die Absatzlage fĂŒr Manganetze ist schlecht, aber der Absatz wird trotzdem auf 70.000 Tonnen pro Jahr gesteigert. |
| 01.07.1949 |
Nach der Auflösung der "Section des Mines" des französischen "Hohen Kommissariates" in Baden-Baden wird zwangsweise Dr. Jacob Reichert als TreuhÀnder und Bergingenieur Adolf Schiffner als Direktor bestimmt. |
| 1950 |
Der Blockbau mit Rahmenzimmerung wird eingefĂŒhrt. |
| 01.11.1950 |
Die Zwangsverwaltung endet am 1. November 1950, nach Neuordnung der deutschen Montanindustrie und aufgrund des Gesetzes Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission in dem von der Firma Mannesmann alle Gruben zusammengefaĂt werden. |
| 1950 |
Die neue Firmenbezeichnung ist ab dem 31.12.1950 "Gewerkschaft Mannesmann" mit dem Sitz in DĂŒsseldorf. |
| 1951 |
Die Waldalgesheimer Erze werden in der niederrheinischen HĂŒtte StĂŒrzelberg im Lohnverfahren gesintert. Der Absatz ist gut; monatlich ca. 8.000 Tonnen. |
| 1952 |
Die Violett-Sohle, auch Rheinsohle genannt, als tiefste Sohle mit 267 m Teufe wird weiter vorgetrieben und in Abbau genommen. |
| 1954 |
Der Straubenschacht mit seiner Heuptförderung erhÀlt Verbindung mit der Rheinsohle. |
| 1954 |
Erstmalige Ăberlegungen, ob sich eine Umstellung von der Mangan auf die Dolomitförderung durchfĂŒhren lassen wĂŒrde. |
| 1954 |
Innerhalb der aufgeschlossenen Feldesteile sind umfangreiche und qualitÀtsvolle Dolomitablagerungen vorzufinden. |
| 1954 |
Die Dolomitberge werden seit 1954 an die RuhrhĂŒtten abgegeben. |
| 11.1954 |
Die Krupp-HĂŒtte in DĂŒsseldorf - Rheinhausen reagiert positiv auf die Rohdolomitangebote. |
| 1958 |
Der Schacht Weiler - West wird bis zur Rheinsohle in einer Teufe von 267 Meter niedergebracht. Seit 1952 wird im Rahmen von umfangreichen Bohrprogrammen festgestellt, daĂ die LagerstĂ€ttenverhĂ€ltnisse unterhalb der Rheinsohle nicht nennenswert fĂŒr Mannesmann sind und VorrĂ€te bald erschöpft sein wĂŒrden. |
| 1958 |
Aufnahme einer gesonderten Dolomitgewinnung im Kammerbau mit Magazinierung des Haufwerkes. |
| 1958 |
Untersuchungen im Max-Planck-Institut in DĂŒsseldorf und in den Laboratorien des HĂŒttenwerkes Huckingen werden angestrengt, ob sich eine Weiterverarbeitung zu feuerfestem Material verwenden lieĂe. |
| 1958 |
Brennversuche in einem Schachtofen des luxemburgischen "Usines À Dolomie et à Chaux" in Wasserbillig und in einem Drehrohrofen von der Friedrich Krupp AG in Rheinhausen. |
| 1958 |
Die "Sinterdolomite" können nach QualitĂ€tsprĂŒfungen mit gutem Erfolg in den Stahlkonvertern der HĂŒttenwerke Huckingen und Rheinhausen eingesetzt werden. Auch die weitere Industrie hat Interesse. |
| 15.07.1958 |
FĂŒr die Mannesmann Grube Ă€ndert sich nochmals die Gesellschaftsform: Die "Gewerkschaft Mannesmann" wird aufgelöst und mit anderen eigenen Erzgruben in der neu gegrĂŒndeten Abteilung "Erzbergbau und Rohstoffbetriebe" der Muttergesellschaft Mannesmann AG in DĂŒsseldorf unmittelbar zugeordnet. |
| 1961 |
Bau einer ölbefeuerten Drehrohrofenanlage auf der Stöckerthöhe. Von 1961 bis 1964 untertage Arbeiten und Vorbereitungen fĂŒr diese Anlage die beschleunigt durchgefĂŒhrt werden. |
| 06.03.1964 |
Die neue Drehrohrofenanlage wird in Betrieb genommen. Förderung: 30.000 Tonnen Dolomit monatlich 4,5 Tonnen Manganerz monatlich |
| 1971 |
Stillegung des gesamten Grubenbetriebes der Grube Dr. Geier. Gesamtförderung seit 1918: 6.000.000 Tonnen Manganerz. |