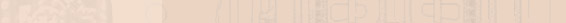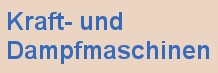| Zeit |
Ereignis |
| 17.07.1821 |
Geburt von Friedrich Engelhorn im Haus "Zur Stadt Augsburg" am Strohmarkt in Mannheim als drittes Kind (weitere vier BrĂŒder und zwei Schwestern) des Gastwirts, Brauers und Essigfabrikanten Johann Conrad Engelhorn (1793-1880) und seiner Frau Marie Christine (geb. Schaeffer). - Das Geburtshaus hatte sein aus Hockenheim stammender GroĂvater Conrad Engelhorn (1769-1827) am 19.11.1788 fĂŒr 19.000 Gulden erworben |
| 1856 |
Der junge William H. Perkin findet in London beim Experimentieren mit Steinkohleteer und dem Versuch, aus Anilin das wohltĂ€tige Chinin herzustellen, den ersten kĂŒnstlichen Teerfarbstoff "Mauvein". |
| 1861 |
Friedrich Engelhorn beginnt die Produktion von Fuchsin, einem roten Farbstoff, und Anilin, dem aus Steinkohleteer gewonnenen Ausgangsstoff. |
| 1865 |
Friedrich Engelhorn wird leitender Direktor der BASF |
| 1865 |
S. Ladenburg wird Vorsitzender des Verwaltungsrats der BASF |
| 1865 |
A. Clemm wird MitbegrĂŒnder der BASF |
| 06.04.1865 |
Engelhorn sieht sich nach der gescheiterten Fusion mit dem "Verein Chemischer Fabriken" veranlaĂt, das Unternehmen auf eine breitere finanzielle Basis zu stellen. Mit Hilfe des befreundeten Bankiers Seligmann Ladenburg wird die BASF durch Umfirmierung aus "Sonntag, Engelhorn & Clemm" als Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1,5 Millionen Gulden gegrĂŒndet. |
| 06.04.1865 |
GrĂŒndung der Aktiengesellschaft Badische Anilin- & Sodafabrik |
| 06.04.1865 |
S. Ladenburg beteiligt sich an der GrĂŒndung der BASF, indem er besonders fĂŒr die Bereitstellung der finanziellen Mittel Sorge trĂ€gt |
| 12.04.1865 |
Das von Engelhorn bei der Mannheimer Stadtverwaltung eingereichte Gesuch um Erwerbung eines im Gewann Rosengarten (am linken oberen Neckarufer) gelegenen GrundstĂŒckes von 144.000 qm wird zwar vom Gemeinderat dem BĂŒrgerausschuĂ zur Annahme empfohlen. An heftiger Debatte aber, in der vor allem der festgesetzte GrundstĂŒckspreis als zu niedrig beanstandet wird, wird Engelhorns Gesuch mit 68 : 42 abgelehnt |
| vor dem 12.04.1865 |
Der Verein Chemischer Fabriken will den GrĂŒndstĂŒckserwerb der BASF vereiteln und gibt vor, dieses GrundstĂŒck fĂŒr einen um mehrere Tausend Gulden höheren Preis erwerben zu wollen. Zu einer vom Gemeinderat spĂ€ter anberaumten öffentlichen Versteigerung des fraglichen GelĂ€ndes erscheint jedoch kein Kaufliebhaber, und der Verein Chemischer Fabriken erklĂ€rt, daĂ er auf sein bedingt gegebenes Gebot verzichte. Der BĂŒrgerausschuĂ lehnt am 12. April mit 68 gegen 42 Stimmen den Verkauf von 40 Morgen in den Neuwiesen an die "Badische Anilin- und Sodafabrik" ab. |
| 12.04.1865 |
Die BASF kauft noch am Tage der Ablehnung des Mannheimer Gesuchs das benötigte GelĂ€nde zu wesentlich gĂŒnstigeren Bedingungen in Ludwigshafen in der NĂ€he der ehemaligen Hemshöfe |
| 01.07.1865 bis 31.12.1865 |
Nach Erteilung der Konzession zur Errichtung einer Fabrik zur Herstellung von Schwefel- und SalpetersĂ€ure, von Sulfat, von rohem und gereinigtem Soda sowie Chlorkalk (10.5.1865): Verlegung auf die Mannheim gegenĂŒberliegende Rheinseite in Ludwigshafen |
| 1866 |
Der erste Werksarzt wird eingestellt |
| 1866 |
Im Ă€uĂersten SĂŒdwesten an das Werk angrenzend entstehen vier HĂ€user mit Wohnungen und SchlafstĂ€tten fĂŒr Arbeiter. |
| 28.06.1866 |
Die pfÀlzische Regierung gibt auch die Genehmigung zur Errichtung einer Gasanstalt und einer Fabrik zur Herstellung von Anilin und Anilinfarben |
| 1867 |
Ein weiteres Fusionsangebot der BASF an den "Verein Chemischer Fabriken" wird von dieser wieder abgelehnt |
| 1867 |
Verleihung einer goldenen Medaille in Paris |
| 11.07.1867 |
Die Anilinproduktion in Ludwigshafen (bisher in Mannheim) lÀuft an |
| 1868 |
Der Chemiker Heinrich Caro tritt bei der BASF ein und ist dort bis 1889 tÀtig |
| 1868 |
Caro wird Leiter der wissenschaftlichen Forschung der BASF |
| 1868 |
Heinrich Caro gelingt in Zusammenarbeit mit den Berliner Professoren Carl Graebe und Carl Liebermann die erste Synthese eines natĂŒrlichen Farbstoffs: Alizarin, der rote Farbstoff der Krappwurzel. Er wird hauptsĂ€chlich in der BaumwollfĂ€rberei eingesetzt und wird zum ersten weltweiten Verkaufserfolg der BASF. - Weitere neue Farbstoffe wie Eosin, Echtrot und Auramin folgen. |
| 1869 |
Clemm wird Vertreter von Engelhorn (leitender Direktor) |
| nach 1868 |
In Gemeinschaft mit H. Caro wird bald nach der Darstellung des Alizarins (1868) das fabrikatorisch allein anwendbare Darstellungsverfahren des Alizarins, AnthrÀpurpurins und Flavopurpurins aus den SulfosÀuren des Anthrachinons ausgearbeitet. |
| 01.10.1869 |
Brunck tritt zusammen mit Glaser in die BASF ein |
| 01.10.1869 |
Glaser tritt zusammen mit seinem Freund und Landsmann Brunck in die BASF ein |
| 1870 |
Herstellung des Alizarins, eine groĂe Erfindung auf dem Farbstoffgebiet |
| 1871 |
Verleihung einer goldenen Medaille in Ulm |
| 1872 |
Es beginnt Bau der groĂen "Hemshof-Kolonie" mit insgesamt ĂŒber 400 Wohnungen, in denen Werksangehörige zu gĂŒnstigen Bedingungen wohnen können. Jedes der KoloniehĂ€user ist freistehend, von GĂ€rten umgeben und in vier separate Wohnungen geteilt. Die HĂ€user fĂŒr Arbeiter sind anderthalbstöckig: Jede Wohnung hat zwei Stuben, eine Kammer, KĂŒche, zwei KellerrĂ€ume und Garten. Die HĂ€user fĂŒr Aufseher und Meister sind zweieinhalbstöckig: Jede Wohnung hat drei Stuben, zwei Kammern, KĂŒche, Kellerraum und Garten. |
| 1872 |
Verleihung einer groĂen goldenen Medaille in Moskau |
| 01.01.1873 |
Fusion mit der Farbenhandlung Rudolf Knosp, Stuttgart |
| 01.01.1873 |
Fusion mit der Farbenhandlung Heinrich Siegle, Stuttgart |
| 1873 |
Ende der Amtszeit von S. Ladenburg als Vorsitzender des Verwaltungsrats der BASF |
| 1873 |
Es wird erstmals ein Logo entwickelt. Links in dem Doppelwappen ist das springende Pferd Stuttgarts; es symbolisiert den ZusammenschluĂ der BASF mit den beiden Stuttgarter Firmen Knosp und Siegle |
| 1873 |
Das erste Firmenzeichen wird eingefĂŒhrt. Es besteht aus zwei nebeneinander stehenden Wappen: links mit springendem Pferd und rechts mit einem stehenden bayerischen Löwen, der ein Wappenschild mit einem Anker hĂ€lt |
| 1873 |
Die BASF ist seither in den USA (New York) prÀsent |
| 1874 |
Karl Ladenburg gehört ab 1874 dem Aufsichtsrat der BASF an |
| 1874 |
Die Firma bringt neue Farbstoffe auf den Markt, welche durch ihre auĂerordentliche Schönheit alsbald das gröĂte Aufsehen erregten: die Resorcinfarbstoffe, Eosin A, S und BN, das Tetrabromfluorescein, sein ĂthylĂ€ther und das Bromnitrofluorescein. |
| 1875 |
Im Zuge des Zusammenschlusses mit Knosp und mit Siegle wird das Aktienkapital auf 16,5 Millionen Mark erhöht |
| 1875 |
Das Alizarinorange, Betanitroalizarin, wird erstmals fabrikmĂ€Ăig bereitet. |
| 1876 |
Es gelingt Heinrich Caro, einen rein blau fĂ€rbenden Farbstoff fĂŒr Baumwolle synthetisch herzustellen: das Methylenblau |
| 1876 |
Erstmals wird das synthetische Purpurin hergestellt. |
| 1877 |
Die BASF erhĂ€lt fĂŒr Methylenblau das erste Deutsche Reichspatent fĂŒr einen Teerfarbstoff. |
| 1877 |
Das von H. Caro entdeckte Methylenblau, einer der wertvollsten Farbstoffe, wird erstmals in den Handel gebracht. |
| 1877 |
Erstmalige Herstellung des SĂ€urefuchsins nebst seinen Verwandten, den SĂ€ureviolets. |
| 1878 |
Errichtung einer BASF-ProduktionsstÀtte in Neuville bei Lyon |
| 1878 |
Errichtung einer BASF-Niederlasssung in Neuville-sur-SaĂŽne in Frankreich |
| 1878 |
Im Echtrot steht dem FĂ€rber ein wertvoller Azofarbstoff dem FĂ€rber zur VerfĂŒgung. |
| 1878 |
Es gelingt H. Brunck, die von Prudhomme beobachtete Reaktion der Bildung des Alizarinblaus zu einem fabrikatorisch anwendbaren Verfahren auszugestalten. |
| 1879 |
Errichtung einer BASF-ProduktionsstÀtte in Butirki bei Moskau |
| 1879 |
Im Naphtolgelb S wird eine ungemein wichtige Errungenschaft dem Patentbesitz der Firma hinzugefĂŒgt. |
| 1879 |
Das LichtgrĂŒn S, eines der ersten SĂ€uregrĂŒne, wird in den Handel gebracht. |
| 1880 |
Adolf von Baeyer, Chemiker in StraĂburg, gelingt im Labor die Synthese des zu dieser Zeit bedeutendsten Naturfarbstoffes Indigo. Die BASF erwirbt zusammen mit den Farbwerken Hoechst die Rechte zur Verwertung des Indigo-Patentes und steigt damit in den Wettlauf um die groĂtechnische Synthese des Naturfarbstoffes ein. Das Unternehmen bringt auch mit der OrthonitrophenylpropiolsĂ€ure ein zur Erzeugung von Indigo auf der Faser geeignetes Produkt in den Handel, dessen Anwendung indessen in Folge seines hohen Preises eine beschrĂ€nkte bleibt. |
| 1880 |
Verleihung eine ersten Preises in Sydney |
| 1881 |
Errichtung des Wasserturms (Er steht noch nach 2000 und ist dann das Àlteste GebÀude des Werkes) |
| 1881 |
H. Brunck arbeitet eine Methode zur Löslichmachung des Alizarinblaus durch dessen Behandlung mit Bisulfiten aus; das Produkt dieses Verfahrens, Alizarinblau S, gelangt seit 1881 in stets wachsenden Mengen in den Handel. |
| 1881 |
Verleihung eine ersten Preises und einer goldenen Medaille in Melbourne |
| 1882 |
Clemm scheidet aus der BASF aus |
| 1882 |
Das Unternehmen hat die Nummer 1 im neugeschaffenen Ludwigshafener Fernsprechnetz |
| 1882 |
Im Blauschwarz B wird der erste der spÀter so zahlreichen schwarzen Azofarbstoffe hergestellt. |
| 1883 |
Ende der Amtszeit Engelhorns leitender Direktor der BASF |
| 1883 |
Carl Clemm scheidet als Leiter des anorganischen Betriebs aus der BASF aus |
| 1883 |
Eugen Sapper (1858-1912) wird Chemiker bis 1887 (und erneut 1890 - 1912) |
| 1883-1885 |
In rascher Reihenfolge entstehen die neuen Triphenylmethanfarbstoffe, deren auf Verwendung von Phosgen begrĂŒndete Darstellungsweise von A. Kern in Gemeinschaft mit H. Caro ausgearbeitet wurde. |
| 1883 |
Die Triphenylmethanfarbstoffe Krystallviolett, Aethylviolet sowie Victoriablau B und 4R werden seitdem hergestellt |
| 1883 |
Verleihung eines Ehrendiploms in Amsterdam |
| 1884 |
Brunck wird zum leitenden technischen Direktor der BASF ernannt |
| 1884 |
Nach Studium in ZĂŒrich tritt Rene Bohn in die BASF ein. |
| 1884 |
Es wird die erste Betriebskrankenkasse gegrĂŒndet. Ihre Leistungen gehen weit ĂŒber die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. |
| 1884 |
Die Triphenylmethanfarbstoffe Nachtblau und Auramin werden seitdem hergestellt |
| 1884 |
Verleihung einer goldenen Medaille in Calcutta |
| 01.10.1884 |
Glaser wird Direktor der BASF |
| 1885 |
Clemm wird Mitglied des Aufsichtsrats der BASF |
| 1885 |
Einrichtung einer eigenen Fernsprechzentrale |
| 1885 |
Das SĂ€ureviolet TB von C. L. MĂŒller, das von J. H. Ziegler erfundene Tartrazin, sowie das Alizarinmarron werden in den Handel gebracht. |
| 1885 |
Verleihung eines Ehrendiploms in Antwerpen |
| 1885 |
Verleihung einer goldenen Medaille in London |
| 1885 |
Verleihung der goldenen Medaille der Society of Arts in London |
| 1886 |
Der Triphenylmethanfarbstoff Alkaliviolet wird seitdem hergestellt |
| 1886 |
Das Acetinblau (C. Schraube), Galloflavin (E. Bohn), Anthracenbraun und Naphtylenroth (A. Römer) werden in den Handel gebracht. |
| 1887 |
Inbetriebnahme eines kleinen 3-kW-Generators, der zwei Lichtbogenlampen am Rheinkai und im Kohlenlager speist. |
| 1887 |
Die Produktion eines neuen schwarzen Azofarbstoffs, des Violettschwarz', wird aufgenommen; es wird ferner im fast vergessenen Naphtazarin von Roussin ein werthvoller Farbstoff erkannt, welcher jetzt als Alizarinschwarz in den Handel kommt. |
| 1887 |
Die von Bohn dargestellte Bisulfitverbindung des Alizarinschwarzes wird als Alizarinschwarz S in die Technik eingefĂŒhrt. |
| 1887 |
Fritz Raschig beginnt als Chemiker bei der BASF. Er arbeitet an der Synthese von BenzoesÀure, KarbolsÀure (Phenol) und PikrinsÀure |
| 1888 |
Lieferung von zwei Dampfmaschinen durch G. Kuhn, Stuttgart-Berg. |
| 1888 |
Rudolf Knietsch (1854-1906, Chemiker bei der BASF von 1884 bis 1906) entwickelt ein wirtschaftliches, alternatives Verfahren fĂŒr die Herstellung der AnthrachinonsulfonsĂ€ure, der Grundsubstanz der Alizarinfarbstoffe. Sie besteht aus drei Benzolringen, an die 2x ein O-Atom bzw. 1x ein HSO3 angegliedert sind. - Die wichtigsten Anbieter von rauchender SchwefelsĂ€ure ("Oleum"), die zur Herstellung von Herstellung der AnthrachinonsulfonsĂ€ure dient,sind böhmische "Vitriolbrennereien", die den steigenden Bedarf nicht mehr decken können; Oleum wird knapp und teuer. Sein SchwefelsĂ€ure-Kontaktverfahren macht die BASF zum weltweit gröĂten SchwefelsĂ€urehersteller der damaligen Zeit. Zugleich ist der Weg zum neuen Gebiet der katalytischen Verfahren eröffnet. |
| 1888 |
Rudolf Knietsch gelingt die VerflĂŒssigung des gasförmigen Elements Chlor. Sie war bislang an der auĂergewöhnlichen AggressivitĂ€t dieses Stoffes gescheitert. Nun kann Chlor, ein wichtiger Grundstoff in der chemischen Industrie, in flĂŒssiger Form gelagert, transportiert und verarbeitet werden. |
| 1888 |
Neben dem HauptverwaltungsgebĂ€ude wird ein zentrales GebĂ€ude fĂŒr die Forschung errichtet. Es erhĂ€lt den Namen "Hauptlaboratorium der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik". Gleichzeitig entsteht ein analytisches Untersuchungslaboratorium und ein Technikum fĂŒr Versuche in kleintechnischem MaĂstab. Auch ein eigenes Patentlaboratorium wird im Hauptlabor eingerichtet, das von Heinrich Caro geleitet wird und in- und auslĂ€ndische Patentfragen bearbeitet. |
| 1888 |
Seit 1877 werden insgesamt 60 aus eigener Forschung hervorgegangene Patente in Deutschland angemeldet. |
| 1888 |
Der Entdeckung der basischen Phtaleinfarbstoffe, deren erster das von Ceresole hergestellte Rhodamin B ist, folgt das von Gnehm hergestellte Rhodamin S. |
| 1888 |
Das durch seine Schönheit ausgezeichnete Nilblau wird erstmals von Th. Reissig hergestellt; ferner das Azocarmin von C. Schraube, das Baumwollgelb G von C. L. MĂŒller, endlich Carbazolgelb, AlizaringrĂŒn, AlizarinblaugrĂŒn und Alizarinindigblau von R. Bohn. |
| 1888 |
Verleihung einer goldenen Medaille in Melbourne |
| 12.11.1888 |
Baubeginn (?) einer Dampfmaschine durch G. Kuhn, Stuttgart-Berg. |
| 1889 |
Caro ist bis 1889 Leiter der wissenschaftlichen Forschung der BASF. Alizarin, Methylenblau, Echtrot, Auramin und andere wertvolle Farbstoffe sind FrĂŒchte seines Schaffens |
| 1889 |
Verlegung des Stuttgarter BĂŒros nach Ludwigshafen wegen der nachteiligen groĂen Entfernung der Verkaufsabteilung von den ProduktionsstĂ€tten |
| 1889 |
Es gelingt, ein schon von P. Philipps (Bristol) im Jahre 1821 angeregtes und erstmals von Cl. Winkler praktisch angewandtes Verfahren, rauchende SchwefelsĂ€ure aus Schwefeldioxid und Luftsauerstoff herzustellen, auĂerordentlich zu vervollkommnen |
| 1889 |
R. Bohn entdeckt das Alizaringelb A, M. V. Nencki das Alizaringelb C und C. L. MĂŒller das Salmrot |
| 1890 |
Caro wird Mitglied des Aufsichtsrats der BASF |
| 1890 |
Mit dem Ausscheiden Caros wird ein PatentbĂŒro eingerichtet, die spĂ€tere Patentabteilung. In einem entsprechenden Rundschreiben der Direktion heiĂt es: "Von heute an wird die Besorgung von Patentangelegenheiten von Herrn Dr. Glaser unter UnterstĂŒtzung des Herrn Anwalt Hecht auf dem Patentbureau erledigt werden." Aufgabe der Patentabteilung ist die Formulierung, Einreichung und Verteidigung der Patentanmeldungen, die Behandlung der Warenzeichen sowie die Bearbeitung von Patentstreitigkeiten mit Wettbewerbern. |
| 1890 |
R. Bohn entdeckt das Azurin |
| 1890 |
Fritz Raschig, Betriebsleiter bei der BASF fĂŒr die Synthesebereiche von BenzoesĂ€ure, KarbolsĂ€ure (Phenol) und PikrinsĂ€ure, ĂŒberwirft sich mit seinem Vorgesetzten, Rudolf Knietsch, und scheidet aus dem Unternehmen aus. |
| 1891 |
Einrichtung einer zentralen "Technischen FÀrberei", des VorlÀufers der spÀteren Anwendungstechnik der BASF (AWETA). |
| 1891 |
Eugen Sapper (1858-1912), Chemiker bei der BASF 1883-1887 und 1890-1912, entdeckt das katalytische PhthalsĂ€ureverfahren. Damit kann PhthalsĂ€ure (ein Benzolring mit zwei Carboxygruppen; eine DicarbonsĂ€ure), die fĂŒr die Herstellung zahlreicher Farbstoffe benötigt wird, einfacher und wirtschaftlicher als bisher hergestellt werden. Durch ein zerbrochenes Thermometer bei Versuchen mit konzentrierter SchwefelsĂ€ure entdeckt er zufĂ€llig die katalytische Wirkung von Quecksilbersulphat bei dieser Reaktion. Es bringt in Verbindung mit dem SchwefelsĂ€ure-Kontaktverfahren nach Winkler und Knietsch (1875) der BADF einen beachtlichen Vorsprung im Wettstreit um eine wirtschaftliche Indigo-Sythese. Es wird um 1925 durch die Gasphasenoxydation von Wohl abgelöst. |
| 1891 |
R. Bohn entdeckt das Anthracenblau, P. Julius das Indoinblau und C. L. MĂŒller das SĂ€ureviolet 6 BN |
| 1892 |
In Dannenfels am Donnersberg beginnt die BASF mit dem Bau der ersten VolksheilstĂ€tte Europas fĂŒr lungenkranke Werksangehörige. |
| 1895 |
Glaser ist bis 1895 Direktor bei der BASF |
| 1895 |
Glaser wird Aufsichtsratsmitglied bei der BASF |
| 1897 |
Herstellung des synthetischen Indigos, eine groĂe Erfindung auf dem Farbstoffgebiet |
| 1897 |
Clemm scheidet als Aufsichtsrat der BASF aus |
| 1897 |
Clemm wird Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF |
| 1897 |
Nach 17 Jahren intensiver Forschung und Aufwendungen von 18 Millionen Goldmark - mehr als das Grundkapital zu dieser Zeit - gelingt es, den synthetischen Farbstoff "Indigo rein BASF" auf den Markt zu bringen. Die BASF gewinnt 1897 das Wettrennen um die Herstellung des "Königs" der Naturfarbstoffe. |
| 1898 |
Unter den neuen Fabrikationen nimmt die wichtigste Stelle der kĂŒnstliche Indigo ein. Die Erwartungen, gestĂŒtzt auf die hervorragenden Eigenschaften dieses Fabrikats, von dessen Aufnahme und AbsatzfĂ€higkeit verwirklichen sich in vollem Umfange. Die Konsumenten ĂŒberzeugen sich an der Hand der durch praktische Versuche erzielten Resultate bald von den groĂen VorzĂŒgen des neuen Indigo und den Vortheilen seiner Verwendung. Alle Zweifel an der IdentitĂ€t des synthetischen Produkts mit dem natĂŒrlichen, welche erhoben wurden, um der EinfĂŒhrung des kĂŒnstlichen Indigo entgegenzuwirken, sind verschwunden. |
| 30.01.1899 |
Carl Bosch bewirbt sich auf Anraten seines Vaters bei der BASF |
| 06.02.1899 |
VorstellungsgesprÀch von Carl Bosch bei der BASF |
| 15.04.1899 |
Carl Bosch tritt bei der BASF im Hauptlaboratorium unter Prof. Dr. Bernthsen ein; seit 1899 [sic] unter Dr. Sapper in der PhtalsÀurefabrik. |
| um 1900 |
Zu Beginn des 20. Jahrunderts wendet sich die BASF auf der Nutzbarmachung des Luftstickstoffs und grĂŒndet gemeinsam mit der Norwegischen Hydro-Elektrischen Stickstoffgesellschaft, den Farbenfabriken, vorm. Friedr. Bayer, Leverkusen und der Actiengesellschaft fĂŒr Anilin-Fabrikation, Berlin, die Norwegischen Salpeterwerke am Rjukanfall |
| 1900 |
Die Anzahl der Patentanmeldungen in Deutschland seit 1889 betrÀgt 468. |
| 1900 |
Es entsteht eine zweite groĂe BASF-Werkskolonie in Limburgerhof. Im GeschĂ€ftsbericht heiĂt es dazu: "Die Landpreise in der unmittelbaren Nachbarschaft der Fabrik sind auf eine ungerechtfertigte Höhe getrieben worden und gestiegen. Dabei hat das Eingreifen von Speculanten es geradezu unmöglich gemacht, groĂe Complexe zu erwerben. Wir haben einen Ausweg gesucht und auch gefunden. Unmittelbar am Bahnhof von Mutterstadt gelegen, welcher mit unserer Fabrik durch die Bahn verbunden und nur 8 Kilometer entfernt ist, haben wir ein gröĂeres Gut (Limburger Hof) erworben, um auf demselben eine Arbeiterkolonie anzulegen, welcher wir eine beliebige Ausdehnung geben können. Die Arbeiter können von dort durch besonders eingelegte BahnzĂŒge direct nach der Fabrik gelangen." |
| Ende Dez. 1900 |
Das Gesellschaftshaus wird in Betrieb genommen. Es bietet Speise- und GesellschaftsrĂ€ume fĂŒr "Beamte" (die leitenden Angestellten des Werks), eine Bibliothek mit Lesehalle fĂŒr Arbeiter und einen Festsaal. |
| 1901 |
Die BASF schenkt der Welt den ersten der "Indanthren"-Farbstoffe, das Indanthren-Blau. Mit dieser Erfindung wird eine Gruppe von Farbstoffen erschlossen, die sich vom Indanthren ableiten. |
| 1901 |
Es gelingt dem Chemiker RenĂ© Bohn (1862-1022), bei der BASF von 1884 bis 1920, die Herstellung des Indanthren-Blau. - Weitere wichtige Erfindungen auf dem Gebiet der Farbstoffe. Indanthren- Blau RS ĂŒbertrifft den Indigo an Wasch- und Lichtechtheit. Die darauf aufbauenden hochwertigen Indanthren-KĂŒpenfarbstoffe (wasserunlösliche Textilfarbstoffe) erschlieĂen dem Coloristen neue Anwendungsmöglichkeiten in TextilfĂ€rberei und -druckerei. Die EinfĂŒhrung von Indigo und Indanthren in der Praxis wird durch die Reduktions- und VerkĂŒpungsmittel "Hydrosulfit konz. BASF" und Rongalit, die die Farbstoffe wĂ€hrend des FĂ€rbeprozesses in eine wasserlösliche Form ĂŒberfĂŒhren, entscheidend gefördert. |
| 1901 |
Fritz GĂŒnther (1877-1957) beginnt als Chemiker. |
| 11.03.1902 |
Tod von Friedrich Engelhorn in Mannheim |
| 1903 |
Karl Ladenburg gehört bis 1903 dem Aufsichtsrat der BASF an |
| 1903 |
Clemm ist bis Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF |
| 1904 |
In Kirchheimbolanden errichtet die BASF ein Heim zur Rekonvaleszenz und Erholung. |
| 1907 |
Brunck tritt in den Aufsichtsrat der BASF ĂŒber |
| 1907 |
Es wird eine beitragsfreie Arbeiter-Pensions-Anstalt ins Leben gerufen, welche Pensionszahlungen an invalid gewordener Arbeiter nach bestimmten GrundsÀtzen entrichtet. |
| 1907 |
Seitdem wird Arbeitern nach zehn Dienstjahren unter Fortzahlung des Verdienstes und GewÀhrung einer Zulage jÀhrlich ein Urlaub von einer Woche gewÀhrt. |
| 10.1907 |
Gemeinsam mit den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, und der Actiengesellschaft fĂŒr Anilin-Fabrikation, Berlin, wird die Steinkohlenzeche Auguste-Victoria, HĂŒls, Kreis Recklinghausen, erworben |
| 1908 |
Die Arbeiten von Fritz Haber (1868-1934, Professor der Chemie in Karlsruhe und Berlin) lassen die technische Synthese von Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff möglich erscheinen. Notwendig hierfĂŒr sind hohe Temperaturen, hoher Druck und Katalysatoren. Die BASF beginnt unter der Leitung von Carl Bosch (1874-1940) mit intensiven Forschungsarbeiten. |
| 1909 |
Die erste kleine Ammoniakanlage der BASF wird errichtet. |
| 1909 |
Die BASF beauftragt Bosch mit der industriellen Umsetzung der Ammoniaksynthese Habers |
| 1910 |
Die erste Ammoniakanlage der BASF wird in die ehemaligen ProduktionsrÀume der Bariumcyanidfabrik verlegt. |
| 1910 |
Tod von Heinrich Caro (vmtl. in Mannheim) |
| 1910 |
Alwin Mittasch findet nach ausgedehnten Experimenten den lang gesuchten idealen Katalysator fĂŒr die Ammoniaksynthese: aktiviertes Eisen. |
| 01.10.1910 bis 20.12.1910 |
Auf das unaufhörliche Platzen der auĂen geheizten, technischen Hochdrucköfen der Ammoniaksynthese zurĂŒckkommend, ĂŒberrascht Carl Bosch mit dem einfach genialen Vorschlag, die Haltbarkeit der Rohre bei DrĂŒcken von 100 - 200 At. und Temperaturen von ca. 500 °C zu erhöhen, indem in das Stahlrohr ein dĂŒnnwandiges Futterrohr einzuziehen ist; kleine Ăffnungen im Mantel dienen dazu, den etwa durch das Innenrohr diffundierenden Wasserstoff entweichen zu lassen. |
| 1911 |
Die erste Ammoniakfabrik produziert ab 1911 tÀglich etwa 1 t Ammoniak |
| 1911 |
Das Unternehmen gehört zu den ersten Kunden der "Deutschen Hollerith-Gesellschaft AG" in Berlin und wird unter der Kundennummer 6 gefĂŒhrt. |
| 12.1911 |
Carl Bosch wird Ende 1911 zum Prokuristen der BASF berufen |
| 1912 |
Die Gesellschaft zieht sich aus dem Norwegischen Salpeterwerken am Rjukanfall zurĂŒck. |
| 1912 |
Als durch das Haber-Bosch-Verfahren die direkte Vereinigung von Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak gelingt, beginnt die BASF nördlich der alten Fabrik in Ludwigshafen den Bau des Werkes Oppau. |
| 1912 |
Glaser wird Aufsichtsratsvorsitzender bei der BASF |
| 1912 |
Die "Stickstoffabteilung" wird gegrĂŒndet. In der ab 1912 selbstĂ€ndigen Fabrikabteilung arbeiten nur noch 9 Chemiker, jedoch 4 Techniker und 120 Arbeiter. Die neue Technologie erfordert vor allem metallkundliche, verfahrenstechnische und chemische Kenntnisse. Leiter der Abteilung ist Bosch. |
| 1912 |
Tod des Chemikers Eugen Sapper (*1858), Chemiker bei der BASF 1883-1887 und wieder seit 1890, der 1891 das katalytische PhthalsÀureverfahren entdeckte. |
| 1912 |
Der Chemiker Alwin Mittasch (1869-1953) wird Leiter des Ammoniaklaboratoriums. |
| 1912 |
Um die wachsenden Materialprobleme und die damit verknĂŒpften Sicherheitsprobleme lösen zu können, wird der erste MaterialprĂŒfungsbetrieb der chemischen Industrie. |
| ab Mai 1912 |
Carl Bosch ist seither damit beauftragt, das neue BASF-Werk Oppau aufzubauen. |
| 1913 |
Der Wert des Exports von kĂŒnstlichem Indigo erreicht einen wertmĂ€Ăigen Umfang von 53.323.00 [sic] Mark |
| 13.04.1913 |
Das "Vereinshaus", spÀter Feierabendhaus genannt, wird eingeweiht. Mit VeranstaltungsrÀumen, Bibliothek, Gastwirtschaft und Kegelbahn dient es der Freizeitgestaltung der Arbeiterschaft. |
| Sommer 1913 |
Inbetriebnahme des neuerbauten Werks in Oppau, das der Synthese von Ammoniak dient. |
| Herbst 1913 |
Die Ammoniakfabrik Oppau nimmt den Betrieb auf und stellt tĂ€glich etwa 30 t Ammoniak her. Die Jahresproduktion: 7.200 Tonnen Ammoniak fĂŒr die Weiterverarbeitung zu 36.000 Tonnen Ammonsulfat |
| 1914 |
GrĂŒndung der Landwirtschaftlichen Versuchanstalt Limburgerhof. |
| Jan. 1914 |
Erwerbung des Gipsstollens in Neckarzimmern fĂŒr den Aufbau einer Ammoniumnitratproduktion. |
| 1914 |
Die BASF eröffnet in Albersweiler-St. Johann ein Erholungsheim fĂŒr Frauen und Kinder ihrer Arbeiter und Angestellten |
| 04.1914 |
Carl Bosch wird zum stellvertretenden Mitglied des Vorstandes der BASF berufen. |
| 28.09.1914 |
Carl Bosch gibt als Folge einer Beratung im Kriegsministerium in Berlin als Berater von BASF-Generaldirektor HĂŒttenmĂŒller der Heeresleitung das "Salpeterversprechen". |
| 1915 |
Inbetriebnahme der Salpeterfabrik Ludwigshafen |
| 1916 |
Carl Bosch wird Vorstandsmitglied der BASF und der "kleinen" I.G. Farben |
| 1916 |
Fritz GĂŒnther entdeckt das Textilhilfsmittel Nekal. Es ist das erste synthetische Tensid, das die OberflĂ€chenspannung des Wassers reduziert und die Waschkraft bisher ĂŒblicher Seifen ĂŒbertrifft. |
| 1916 |
Fritz Winkler (1888-1950) beginnt als Chemiker bei der BASF. |
| 12.04.1916 |
Baubeginn (?) von sieben Dampfmaschinen durch die Maschinenfabrik Esslingen. |
| 27.04.1916 |
Infolge der Notwendigkeit erhöhter Stickstofferzeugung beginnt die BASF mit dem Bau des Ammoniakwerkes Merseburg |
| 07.1916 |
Nach vorher nur beratender TĂ€tigkeit steigt Bosch Mitte 1916 vom ausfĂŒhrenden Direktor der Ammoniakfabrik Oppau zum eigenverantwortlichen Manager im Vorstand der BASF auf. |
| Herbst 1916 |
Die BASF beginnt auf einem GrundstĂŒck von knapp 30 Hektar und etwa 1,5 km LĂ€nge entlang des Neckars mit dem Bau des auf eine Monatsproduktion von 5000 Tonnen Schwefel ausgelegten Reichsschwefelwerks. Es soll 60 Millionen Mark kosten und in 6 Monaten in Betrieb gehen. Eingesetzt werden 2500 Menschen, darunter französische, belgische und russische Kriegsgefangene. |
| 1917 |
Die BASF beginnt Aktien der Zuckerfabrik Körbisdorf wegen der zur Fabrik gehörenden Kohlefelder zu kaufen. |
| April 1917 |
Nach kurzer Bauzeit wird das zweite Ammoniakwerk der BASF in Leuna bei Merseburg angefahren. |
| 20.06.1917 |
Baubeginn (?) einer Dampfmaschine durch die Maschinenfabrik Esslingen. |
| 13.08.1917 |
Baubeginn (?) einer Dampfmaschine durch die Maschinenfabrik Esslingen. |
| 1918 |
Lieferung von 6 Pelton-Turbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1919 |
Glaser ist bis 1919 Aufsichtsratsmitglied bei der BASF |
| 1919 |
Glaser ist bis Aufsichtsratsvorsitzender bei der BASF |
| 1919 |
Carl Bosch (1874-1940) wird Vorstandsvorsitzender der BASF |
| 1919 |
Kauf des VerwaltungsgebĂ€udes des "Reichsschwefelwerks" in HaĂmersheim fĂŒr 55.000 Mark. Man trĂ€gt es ab und stellt es in Ludwigshafen wieder auf. |
| 30.06.1919 |
Ein Gutachten von Fritz Haber und Herrn Königsberger mit dem Titel "VerhĂ€ltnisse in der Schwefelfabrik Neckarzimmern", gerichtet an das Reichsschatzministerium kommt zur EinschĂ€tzung, daĂ im Werk Neckarzimmern Schwefel in der vorgesehenen Weise nicht störungsfrei hergestellt werden könne, da es nicht gelang die im Kleinversuch gĂŒnstigen Ergebnisse auch im GroĂen zu erreichen. Zur Verbesserung des Prozesses laufen jedoch Versuche. Auch fĂŒr die anfallende Schlacke sieht man eine Lösung, sie soll nach einem Verfahren von Diehl zu Herstellung von Schlackensteinen verwendet werden. Solange diese Optimierungsversuche nicht abgeschlossen sind, habe die BASF kein Interesse, an diesem Standort andere chemische Produkte zu produzieren. |
| 01.07.1919 |
Verlegung des handelsrechtlichen Sitzes der Badischen Anilin- und Sodafabrik von Mannheim nach Ludwigshafen |
| Juli 1919 |
AbschluĂ des ersten Tarifvertrags in der chemischen Industrie, in dem der von den Gewerkschaften der seit langem geforderte Acht-Stunden-Tag festgeschrieben wird. |
| 1920 |
Die an Teilen des "Reichsschwefelwerk Neckarzimmern" (Bahnanlage und Lokschuppen, den Seilbahnen, am Gipsstollen Carl Bosch, am Silobau, der Sprenglufthalle und den Elektroeinrichtungen) interessierte BASF erhöht ihr erstes Angebot zur Ăbernahme. |
| 1920 |
Der der erste Betriebsrat wird gewÀhlt |
| 1920 |
Matthias Pier (1882-1965) beginnt als Chemiker |
| 21.09.1921 |
Eine Explosion um 7.32 Uhr in einem BASF-Stickstoffwerk legt weite Teile der angrenzenden Orte in TrĂŒmmer. Rund 4.500 t (auch 40.000 t genannt) Ammoniumsulfatsalpeter (Mischung aus Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat) fliegen in die Luft. Vermutlich haben Lockerungssprengungen das UnglĂŒck ausgelöst. 561 Tote und 1952 Verletzte sind bei dem UnglĂŒck zu beklagen. Folge der Explosion sind zerfetzte HĂ€user (in Oppau werden von vom 1000 HĂ€usern 800 völlig zerstört) mit 7.500 Obdachlosen und ein gigantischer Trichter: 125 Meter lang, 90 Meter breit und 19 Meter tief (nach anderen Quellen: 165 x 96 x 18 m). |
| 1921 |
Die Produktion von Ammoniumsulfatsalpeter (26 % Stickstoff und 13 bis 15 % Schwefel in Form von Sulfat) ruht seit der Explosion bis 1941 |
| 10.12.1921 |
Das Reich ist vmtl. zum Verkauf der Werksanlagen des "Reichsschwefelwerks" fĂŒr 20 Millionen Mark an die BASF bereit, jedoch unter der Auflage, daĂ ein Weiterverkauf fĂŒr die nĂ€chsten 20 Jahre ausgeschlossen sei. |
| 1922 |
Erstmals taucht der Schriftzug BASF im Logo auf (zweizeilig, in einer stehenden Ellipse) |
| 1922 |
Das neue Firmenzeichen besteht aus einer stehenden Ellipse mit waagerechtem Durchmesser-Strich; darĂŒber "BA" und darunter "SF" |
| 1922 |
Der Betriebsrat entsendet nur auch Vertreter in den Aufsichtsrat des Unternehmens. |
| 1922 |
Matthias Pier gelingt die Methanolsynthese. Der Holzgeist wird nun durch das synthetische Methanol ersetzt. |
| 1922 |
Es gelingt, Harnstoff in groĂtechnischem MaĂstab aus Ammoniak und KohlensĂ€ure herzustellen. |
| 1924 |
Nach seiner Promotion beginnt Ulrich Hoffmann als Betriebstechniker im Hauptlabor der "Badischen Anilin- und Farbenfabrik" in Ludwigshafen |
| 1924 |
Der Chemiker Fritz Winkler entdeckt das Prinzip der "Wirbelschicht". Mit diesem technischen Kunstgriff erhĂ€lt man beim Verkoken von feinkörniger Braunkohle ein vorzĂŒgliches Brenngas. |
| 1924 |
Seitdem wird feinteiliges Carbonyleisenpulver fĂŒr die Induktionsspulen von Fernsprechleitungen hergestellt. |
| 1925 |
Ende der Amtszeit von Carl Bosch als Vorstandsvorsitzender der BASF |
| 02.12.1925 |
ZusammenschluĂ der Firmen der Interessengemeinschaft der deutschen Teerfarbenfabriken, nĂ€mlich die: die Badische Anilin- und Sodafabrik, die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., die Farbwerke Hoechst, die Chemische Fabrik Griesheim, die Chemische Fabrik Weiler ter-Mer, die Cassella AG und die Kalle & Co. Die BörseneinfĂŒhrung der neuen Aktien nimmt ein Konsortium unter FĂŒhrung der Deutschen Bank und der Danatbank vor. |
| 1926 |
Beim Reichspatentamt wird das Warenzeichen "Nitrophoska" eingetragen. Die Wortbestandteile weisen auf die drei wichtigsten HauptnĂ€hrstoffe fĂŒr Pflanzen hin: Stickstoff (Nitrogenium), Phosphat und Kali. Der DĂŒnger stellt etwas völlig Neues dar, liegt doch die NĂ€hrstoffkonzentration zwei- bis dreimal höher als bei den bislang bekannten MischdĂŒngern. |
| 1927 |
Hoffmann wechselt zur Indigo-Abteilung der BASF. Dort ist er an der Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von 1,3-Butadien beteiligt, das spĂ€ter in den Bunawerken Schkopau und "Chemische Werke HĂŒls GmbH", Marl, verwendet wird. |
| 1927 |
Das DĂŒngemittel "Nitrophoska" kommt auf den Markt. Es löst die bisherigen Probleme beim Mischen der verschiedenen synthetischen DĂŒnger unterschiedlicher Herkunft, denn jedes DĂŒngerkorn ist homogen zusammengesetzt. |
| 1927 |
Der BASF-Chemiker Matthias Pier greift den Gedanken, aus Steinkohle unter hohem Druck und durch Einwirkung von Wasserstoff flĂŒssige Reaktionsprodukte zu erhalten, auf und gelangt in kurzer Zeit zur groĂtechnischen AusfĂŒhrung. Ende des Jahres verlĂ€Ăt der erste Kesselwagen mit Autobenzin aus Kohle die Leuna-Werke. |
| Winter 1928/29 |
Im strengen Winter 1928/29 bringt die I.G. Farben das erste Frostschutzmittel fĂŒr Automobile, "Glysantin", auf den Markt. GegenĂŒber den bis dahin verwendeten Zusatzstoffen hat es entscheidende Vorteile: Siedepunkt bei 197 Grad Celsius, Korrosionsschutz, keine Entmischung, keine nennenswerte Verdunstung und eine fĂŒr Mitteleuropa ausreichende Gefrierpunktabsenkung bis minus 25 Grad Celsius. |
| 1929 |
Beginn der Styrolsynthese |
| 1929 |
Polymere Acrylverbindungen werden fĂŒr die groĂtechnische Kunststoffproduktion erschlossen. |
| 1930 |
Polystyrol wird fĂŒr die groĂtechnische Kunststoffproduktion erschlossen. |
| 1931 |
Polyvinylchlorid und Polyisobutylen werden fĂŒr die groĂtechnische Kunststoffproduktion erschlossen. |
| 1931 |
Der auf den Grundstoffen Harnstoff und Formaldehyd basierende Kaurit-Leim wird in den Handel gebracht. Er erlangt fĂŒr die holzverarbeitende Industrie und das Holzhandwerk groĂe Bedeutung. Vor allem das Sperrholz, bislang nur Abfallprodukt, wird zu einem hochwertigen Werkstoff mit vielen neuen Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. |
| 1932 |
Die AEG ĂŒbernimmt die Pfleumersche Idee des Magnetbands, und die BASF kommt ins Spiel: sie soll die TontrĂ€ger herstellen. In diesem Jahr werden die ersten 50.000 Magnetophonband ausgeliefert. |
| 1932 |
Ende der Amtszeit von Alwin Mittasch als Leiter des Ammoniaklaboratoriums |
| 1933 |
Tod von Carl Glaser (vmtl. in Mannheim) |
| 1934 |
Polyvinylether wird fĂŒr die groĂtechnische Kunststoffproduktion erschlossen. |
| 1934 |
Die ersten 50.000 Meter Magnetophonband werden ausgeliefert. |
| 1935 |
Die BASF stellt zusammen mit der AEG das "Magnetophonband" vor. |
| 1935 |
Das erste "Magnetophon" wird auf der Funkausstellung in Berlin vorgestellt. |
| 1936 |
Die intensiven Forschungen ĂŒber synthetischen Kautschuk fĂŒhren zum Erfolg: Im "Buna"-Werk beginnt die Produktion fĂŒr ReifenbelĂ€ge und einer Vielzahl anderer kĂŒnstlicher Gummistoffe. |
| 19.11.1936 |
Im Feierabendhaus wird ein von Sir Thomas Beecham dirigiertes Konzert der Londoner Philharmoniker auf Tonband aufgezeichnet. |
| 1937 |
Polyethylen wird fĂŒr die groĂtechnische Kunststoffproduktion erschlossen. |
| 1937 |
Die I.G. Farben erhĂ€lt neun "Grands Prix" fĂŒr ihre Produkte und Verfahren. Darunter sind KohleverflĂŒssigung, Buna und Indanthren. |
| 1938 |
Karl Wurster wird Leiter der I.G. Farben-Werke Ludwigshafen und Oppau |
| 1938 |
Lieferung von 3 Peltonturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1938 |
Seitdem wird zusÀtzlich Strom von der RWE Aktiengesellschaft bezogen. - Bisher war das Werk autark. |
| 1938 |
Der Chemiker Fritz GĂŒnther scheidet aus |
| 1939 |
Das Polyvinylpyrrolidon (PVP), Folgeprodukte der Acetylenchemie, wird zum Patent angemeldet. Es wird zuerst als Blutplasmaersatz eingesetzt und dient spÀter in den verschiedensten Anwendungen in Medizin, Pharmazie, Kosmetik und technischer Industrie. |
| 1940 |
Lieferung von 13 Peltonturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1940 |
Bau einer GroĂanlage fĂŒr die Herstellung von Butindiol aus Acetylen und Formaldehyd nach einem von Walter Reppe entwickelten Dreistufenverfahren. Es ist die dritte Buna-Anlage der I.G. Farben. Sie verbindet die bislang auseinander liegenden Werke Ludwigshafen und Oppau. |
| 1940 |
Das kohlebetriebene Kraftwerk Mitte entsteht gleichzeitig mit der GroĂanlage fĂŒr die Herstellung von Butindiol aus Acetylen und Formaldehyd (der dritten Buna-Anlage der I.G. Farben) zwischen den Werken Ludwigshafen und Oppau. |
| 1941 |
Lieferung von 6 Peltonturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| Ende 1944 |
Die Produktion kommt nach massiven Luftangriffen fast zum Erliegen. |
| vor Weihn. 1944 |
Kurz vor Weihnachten kann mit der Zementbeförderung von Leimen zur BASF mit der StraĂenbahn begonnen werden. |
| 23.03.1945 |
Karl Wurster wird von den amerikanischen MilitÀrbehörden verhaftet und verhört |
| 01.05.1945 bis 30.06.1945 |
Bis Ende Juni 1945 werden 750 BeschÀftigte im Zuge einer ersten Entnazifizierung entlassen |
| Ende 2. Weltkrieg |
Das AusmaĂ der Zerstörung bei Kriegsende ist enorm: Von 1.470 FabrikgebĂ€uden sind 33 Prozent völlig zerstört, 61 Prozent teilbeschĂ€digt und nur sechs Prozent unversehrt. Weit ĂŒber 400.000 Kubikmeter Schutt bedecken das FabrikgelĂ€nde. |
| 10.07.1945 |
Nach dem Wechsel der Besatzungsmacht setzen die französischen Behörden Karl Wurster wieder in sein Amt ein. |
| 24.07.1945 |
Die Werke Ludwigshafen und Oppau werden "der AutoritÀt des französischen Sequesterverwalters" unterstellt |
| 1947 |
Carl Wurster wird an die Amerikaner ĂŒberstellt und im ProzeĂ gegen die I.G. Farben angeklagt. Freispruch in allen Anklagepunkten |
| 1947 |
Erste Betriebsratswahlen nach dem Krieg |
| 28.07.1948 |
Im Werksteil SĂŒd ereignet sich die Explosion eines vmtl. ĂŒberhitzen, undichten Kesselwagens mit 30 Tonnen DimethylĂ€ther, bei der 178 (oder 207) Menschen ums Leben kommen. 3818 Personen werden verletzt. 3122 GebĂ€ude werden in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden betrĂ€gt rund 80 Millionen Mark. |
| 1949 |
Die Demontage durch die Alliierten setzt ein. Es werden unter anderem Anlagen fĂŒr die Herstellung von Methanol, Ammoniak, synthetischem Kautschuk und Formaldehyd ganz oder teilweise demontiert |
| 1949 |
Der Chemiker Matthias Pier (Entdecker der Methanolsynthese) scheidet aus. |
| 1949 |
Nach dreijĂ€hriger PrĂŒfung durch die Landwirtschaftliche Versuchsstation kommt das UnkrautbekĂ€mpfungsmittel "U46" auf den Markt. Als selektives Herbizid wird U46 hauptsĂ€chlich im Getreideanbau eingesetzt. |
| 1950 |
Die BASF liefert die ersten magnetischen harten SchichtbÀnder. |
| 1950 |
BASF lĂ€Ăt sich die Methode, niedrigsiedende FlĂŒssigkeiten beim HerstellungsprozeĂ als Treibmittel zu verwenden, schĂŒtzen. |
| 1950 |
Tod von Fritz Winkler, der 1924 das Prinzip der "Wirbelschicht" entdeckt hatte |
| 1950 |
Das Wirbelschicht-Röstverfahren von Schwefelkies zur Herstellung von SchwefelsÀure wird entwickelt. |
| 10.1950 |
AbschluĂ der Demontagen im Oktober |
| 1951 |
Lieferung von 2 Peltonturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1951 |
Der Kunststoff Styropor wird entdeckt, der den Weltmarkt erobern soll. Der weiĂe Hartschaum besteht zu 98 Prozent aus Luft und fesselt deren wichtige Eigenschaft: die hohe IsolierfĂ€higkeit. |
| 1952 |
Das Styropor wird auf der DĂŒsseldorfer Kunststoffmesse vorgestellt. |
| 1952 |
Das geĂ€nderte Firmenzeichen Ă€hnelt dem von 1873: Ein Kreis und darin zwei nebeneinander stehende Wappen: links ein schwarzes springendes Pferd und reichts ein schwarzer, stehende bayerische Löwen, der ein Wappenschild mit einem Anker hĂ€lt; zwischen den Wappen das GrĂŒndungsjahr |
| 1952 |
Der Chemiker Walter Reppe (1892-1969) wird Vorstandsmitglied der BASF. |
| 1952 |
Der Wiederaufbau des Ludwigshafener Werkes macht im GeschĂ€ftsjahr weiterhin groĂe Fortschritte und nĂ€hert sich in den wichtigsten Teilen seinem AbschluĂ. Der Wiederaufbau wurde nach einem auf weite Sicht angelegten Plan durchgefĂŒhrt und ermöglicht zugleich eine grundlegende Modernisierung, die sich in den folgenden Jahren sowohl in einem erhöhten Produktionsvolumen wie in sinkenden Produktionskosten ausdrĂŒcken wird. |
| 30.01.1952 |
Nach langen Entflechtungsverhandlungen wird die "Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG" als eine der drei Nachfolgegesellschaften der I.G. Farben gegrĂŒndet. |
| 03.1952 |
BASF-Ingenieur Dr. Fritz Stastny erfindet das Styropor. |
| 1953 |
AbschluĂ der I.G.-Farben-Entflechtung und NeugrĂŒndung der BASF |
| 1953 |
Das erste Langspielband wird der Welt vorgestellt. |
| 1953 |
EinfĂŒhrung eines neuen Firmenzeichens: ein kantiges "BASF" mit dicken Serifen - als voller Schriftzug oder als dicke Konturenschrift |
| 1953 |
Gemeinsam mit der "Deutschen Shell AG" werden in Wesseling am Rhein die "Rheinische Olefinwerke GmbH" (ROW) gegrĂŒndet, die erste deutsche petrochemische Produktionsanlage. Das Unternehmen produziert vor allem den Kunststoff Polyethylen, der bei der BASF Lupolen heiĂt. Erdöl verdrĂ€ngt die Kohle als Rohstoff fĂŒr Chemiesynthesen. |
| 17.11.1953 |
Unfall im Bau E 206: Bei der Herstellung von Trichlorphenol kommt es in einem groĂen Autoklaven. Der DruckbehĂ€lter entleert sich ĂŒber ein Sicherheitsventil. Es entsteht Dioxin (TCDD). Drei Schlosser werden verletzt, einer von ihnen stirbt einige Monate spĂ€ter. - Der Unfall wird erst am 29. Juni 1984 bekanntgemacht. |
| 1954 |
Lieferung von 7 Peltonturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1955 |
Lieferung von 3 Francis-Spiralturbinen und 7 Peltonturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1955 |
Das neu eingefĂŒhrte Firmenzeichen Ă€hnelt dem von 1922: Stehende Ellipse, oben "BA" und unten "SF", aber in Schachbrett-Anordnung: oben links und unten rechts schwarz, die anderen Felder weiĂ; unten teils mit einem Ăhrenkranz |
| 1955 |
Die sozialpolitischen Regelungen werden in einer ersten Betriebsvereinbarung zusammengefaĂt. |
| 1955 |
Neben den ursprĂŒnglichen Erholungsheimen in der engeren Umgebung werden HĂ€user in Breitnau, Schwarzwald, und Westerland auf Sylt erworben. |
| 1955 |
In GuaratinguetĂĄ nimmt die BASF zusammen mit brasilianischen Partnern gegrĂŒndete Firma "Idrongal" die Produktion von Kunststoffdispersionen, Styropor und Textilhilfsmitteln auf. - Mit zwölf Produktionsanlagen, die ĂŒber 750 verschiedene Produkte mit einer KapazitĂ€t von insgesamt 260.000 Tonnen im Jahr herstellen, wird GuaratinguetĂĄ spĂ€ter der gröĂte Standort der BASF in SĂŒdamerika. |
| 1956 |
Die Firma "R. Stahl", Stuttgart, baut den ersten vollautomatischen Aktenpaternoster im Hochhaus der BASF ein. |
| 1956 |
Tod von Friedrich (Fritz) Engelhorn (vmtl. in Mannheim) |
| 1956 |
Verkauf des Gipssilos des "Reichsschwefelwerks" an die Malzfabrik Kwasny, und die restliche FlĂ€che wird fĂŒr 150.000 DM an die Gemeinde HaĂmersheim verkauft. |
| 1956 |
Die Synthese von Hydroxylamin durch katalytische Hydrierung von Stickoxid mit Wasserstoff erschlieĂt einen wirtschaftlichen Herstellungsweg fĂŒr Caprolactam, das Vorprodukt fĂŒr Polyamid-Synthesefasern. |
| 1957 |
Lieferung von 2 Francis-Spiralturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1957 |
Versuch der thermischen Ălspaltung zur Olefinerzeugung in Zusammenarbeit mit der "Dr. Otto & Co.", Bochum |
| 1957 |
Walter Reppe scheidet als Vorstandsmitglied aus. |
| 1957 |
Errichtung des 102 m hohen Friedrich-Engelhorn-Hauses als erster Hochhausbau mit einer Stahlbetonkonstruktion. Die Fassade besteht aus elf Millionen Glasmosaiksteinchen. - Im MÀrz bezieht die Verkaufsorganisation das GebÀude. |
| 1958 |
GrĂŒndung des Gemeinschaftsunternehmens "Dow Badische" zusammen mit dem US-Konzern "Dow Chemical" |
| 1959 |
Lieferung einer Francis-Spiralturbine durch J. M. Voith, Heidenheim |
| Ende 1959 |
Die BASF-Aktie wird an der Pariser Börse eingefĂŒhrt |
| 1960 |
Lieferung von 3 Francis-Spiralturbinen und 2 Peltonturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| Anfang 1960 |
Die BASF-Aktie wird an den drei Schweizer Börsen ZĂŒrich, Basel und Genf eingefĂŒhrt. |
| 1960 |
Zu den Farbstoffen fĂŒr Wolle und Baumwolle kommen Sortimente hinzu, mit denen sich vollsynthetische Fasern fĂ€rben lassen: Palanil und Basacryl. |
| 1960 |
Die ersten italienischen Mitarbeiter kommen zur BASF. - Spanier, Griechen Jugoslawen und TĂŒrken folgen, aber auch Deutsch-Brasilianer und Vietnam-FlĂŒchtlinge. |
| 1961 |
Lieferung einer Francis-Spiralturbine durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1961 |
Mit "Floranid" wird der erste synthetisch-organische LangzeitdĂŒnger auf den Markt gebracht. |
| 1962 |
Seitdem stehen das Kunststoff- und das Farbenlaboratorium als selbststĂ€ndige Einrichtungen neben den beiden traditionsreichen ForschungsstĂ€tten, dem Hauptlaboratorium und dem Ammoniaklaboratorium. Dadurch können groĂe Arbeitsgebiete organisatorisch enger zusammengefasst werden. Zugleich wird die Verbindung der Forschung zu Produktionsabteilungen und anwendungstechnischen Stellen vertieft. |
| 1963 |
In Japan nimmt die "Yuka Badische Company Ltd." die Produktion von Styropor auf. Sie ist wegen der schwierigen Anforderungen, die der japanische Markt an auslÀndische Unternehmen stellt, eine Gemeinschaftsanlage mit einem japanischen Partner. |
| 1964 |
GrĂŒndung der BASF Antwerpen. - In kurzer Zeit entwickelt sie sich zum zweitgröĂten europĂ€ischen Standort der BASF. Der gĂŒnstige Zugang zu den Rohstoffquellen und die gute Logistik zu den Kunden in Ăbersee fördert diese Entwicklung. Produziert werden DĂŒngemittel, Faservorprodukte, Kunststoffe und Chemikalien. |
| 1964 |
"Pyramin" kommt als neuartiges, selektiv wirkendes Mittel zur BekĂ€mpfung von Unkraut in RĂŒben in den Handel. |
| 1965 |
Lieferung von 2 Francis-Spiralturbinen durch J. M. Voith, Heidenheim |
| 1965 |
Die BASF ist seit 1965 im DruckplattengeschÀft tÀtig |
| 05.1965 |
Bernhard Timm, Sohn eines GetreidehÀndlers aus Pinneberg, wird Chef der BASF. |
| Herbst 1965 |
Ăbernahme der "Glasurit-Werke M. Winkelmann AG" in (MĂŒnster-)Hiltrup eines der gröĂten Unternehmen der europĂ€ischen Lackindustrie fĂŒr 250 Millionen Mark gegen die interessierten Konkurrenten Bayer und Hoechst. |
| 1966 |
Das BASF-Werk WillstÀtt wird eingeweiht. |
| 1966 |
Die Cottestren-Farbstoffe, mit denen sich Mischgewebe aus Baumwolle- und Polyesterfasern fÀrben lassen, kommen heraus. |
| 29.12.1966 |
Ein ExplosionsunglĂŒck auf dem GelĂ€nde der BASF in Ludwigshafen fordert 63 Verletzte und verursacht 5 Mio. DM Sachschaden. |
| 1967 |
Als neues Firmenzeichen dient ein breites, schwarzes Rechteck mit der dĂŒnnen Negativschrift "BASF" |
| 1967 |
ErgĂ€nzung des Produktionsprogramms von Glasurit durch die Ăbernahme der "Dr. Beck & Co. AG". Dieses Unternehmen ist auf die Herstellung von Isolierlacken und Isolationswerkstoffen fĂŒr die Elektroindustrie spezialisiert. |
| FrĂŒhjahr 1967 |
Die BASF erwirbt in Hamburg fĂŒr 155 Millionen DM die Chemiefaser-Gesellschaft Phrix. |
| Herbst 1967 |
Ăbernahme der Arzneimittelfabrik "Nordmark-Werke" fĂŒr 100 Millionen Mark |
| 1968 |
Ăbernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der "Herbol-Werke Herbig Haarhaus AG" |
| 1968 |
Bernhard Timm bietet den Erben der "Herbig-Haarhaus Aktiengesellschaft", Herbig und Hugenberg, fĂŒr ihre Herbol-Pakete einen Kurs von 520 Punkten pro Aktie an. Nach monatelangem Feilschen erhöht er seine Offerte auf 600 Punkte. Die AktionĂ€rin Hanne Herbig aus Bad Ems aber wittert ein noch gröĂeres GeschĂ€ft. Frau Herbig, die 21 Prozent aller Herbol-Anteile (2,1 Millionen nominal) besitzt, faĂt einen weiteren möglichen Interessenten ins Auge. Sie reist nach Leverkusen zum BASF-Konkurrenten Bayer, wo sie der Finanzvorstand Hanns Gierlichs rasch versteht. Bayer erklĂ€rt sich bereit, fĂŒr jede Herbol-Aktie 700 Mark anzulegen. Timm, der unterdessen mit den Familien Herbig und Hugenberg weiter verhandelt, treibt sein Angebot auf Bayer-Kurs hoch, als er von dem Manöver der Leverkusener Wind bekommt. Frau Luise Herbig, Dr. Jost Herbig und die Opriba schlagen ein und kassieren 50 Millionen Mark. Die BASF ist sich sicher, auch die Anteile von Hanne Herbig in die Hand zu bekommen, aber die Emser Herbol-AktionĂ€rin schlĂ€gt das Angebot der BASF aus. Sie schafft zusĂ€tzlich "noch vier Prozent von einer Tante" herbei. FĂŒr die Schachtel von 25 Prozent zahlt Bayer-Chef Hansen 17,5 Millionen DM. Laut Aktiengesetz kann Bayer mit seinem 25-Prozent-Anteil alle wichtigen Vorhaben des GroĂaktionĂ€rs BASF bei Herbol verhindern. |
| 1969 |
Die Firma Wyandotte in den USA wird gekauft |
| 1969 |
Ăbernahme des Ăl- und Kalikonzerns "Wintershall AG" in Kassel. - Schon 1968 hĂ€lt die BASF 840 Millionen Mark bereit, um die Wintershall-Gruppe (Jahresumsatz 1,5 Milliarden Mark) in seinen Trust einzugliedern. |
| 1970 |
Ăbernahme der Stuttgarter Firma "K+E" und deren GeschĂ€ft mit Druckfarben |
| 1970 |
Die BASF AG, Ludwigshafen, erwirbt den Anteil der amerikanischen Gesellschafter der Röhm & Haas GmbH Darmstadt. Diese hatten vormals dem MitbegrĂŒnder Otto Haas und dessen Familie gehört. Der 1960 verstorbene Haas hatte bereits 1909 in Philadelphia/USA eine Filiale des DarmstĂ€dter Unternehmens eröffnet. |
| 1970 |
VollstĂ€ndige Ăbernahme der Herbol-Standorte Köln und WĂŒrzburg |
| 1971 |
Die erste Compact-Casette mit Chromdioxid-Pigmenten wird im Werk WillstÀtt hergestellt. |
| 1972 |
Bildung der Tochtergesellschaft "BASF Farben + Fasern AG" |
| 1973 |
Hauptversammlung eine Modernisierung des Firmennamens aus "Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG" in "BASF Aktiengesellschaft" |
| 1977 |
VideobÀnder kommen auf den Markt. |
| 1978 |
Produktion von Farbstoffen, die sich zum Bedrucken von Mischgeweben aus Baumwolle- und Polyesterfasern eignen. |
| 16.06.1979 |
Rund 400 Tonnen Kunststoffe sowie Pflanzenschutzmittel und Insektengifte verbrennen im Zentrallager. - Der rheinland- pfĂ€lzische Sozialminister Georg Gölter kĂŒndigt schĂ€rfere Kontrollen fĂŒr die Lagerung gefĂ€hrlicher Stoffe an. |
| 1985 |
Das neue Firmenzeichen besteht aus dem fetten, engstehenden, serifenlosen Schriftzug "BASF" |
| 1985 |
Kauf des amerikanischen Farben- und Lackherstellers Inmont fĂŒr den immens hohen Betrag von 3 Mrd. DM |
| 1988 |
Eine eigene BASF-Anlage in Japan die Produktion von Hilfsmitteln auf. - Bisher gab es nur Gemeinschaftsanlagen mit japanischen Partnern. |
| 1989-1994 |
DurchfĂŒhrung des Mamutinvestitionsprogramm von 1,2 Milliarden DM. |
| 1989-1994 |
Die Abwassermenge verringert sich um 35 Prozent, die darin enthaltene Restverschmutzung um ĂŒber 40 Prozent und die Ammoniumbelastung um 77 Prozent. |
| 12.1990 |
Das Unternehmen zÀhlt 50 570 BeschÀftigte. |
| 1991 |
GrĂŒndung der BASF Magnetics mit Sitz in Mannheim. Sie ĂŒbernimmt die MagnetbandaktivitĂ€ten von Agfa-Gevaert |
| 1991-1994 |
Die BASF investiert an ihrem brandenburgischen Standort rund 150 Millionen DM in UmweltschutzmaĂnahmen. |
| 1994 |
Die Investitionen in den Umweltschutz sinken auf 73 Millionen DM. |
| 1994 |
Die Emissionen gehen weiter zurĂŒck. |
| 1994 |
Es werden noch 58 000 BetriebsrĂŒckstĂ€nde auf der werkseigenen Deponie gelagert. |
| 01.12.1994 bis 31.12.1995 |
Das Unternehmen zÀhlt 43 332 BeschÀftigte. |
| 01.01.1995 bis 31.03.1995 |
In der BASF-Gruppe steigt das Ergebnis vor Ertragssteuern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 152 Prozent auf 880 Millionen DM. |
| 03.1995 |
Im MĂ€rz sind die letzten StĂŒcke des alten Kraftwerks im Werksteil SĂŒd gesprengt |
| 04.1995 |
Kauf der Pharmasparte des britischen Konzerns The Boots Company fĂŒr 1,9 Mrd. DM |
| 01.05.1995 bis 31.12.1995 |
BASF stockt die Mitarbeiterzahl von 41 886 auf 42 500 auf. |
| 16.07.1995 |
Ein Toter, drei Verletzte Bei einer durch geplatzte GlasbehĂ€lter ausgelösten Verpuffung in einem Labor der BASF werden vier Chemiefacharbeiter schwer verletzt. Einer von ihnen stirbt eine Woche spĂ€ter. Das nach der Verpuffung ausgebrochene Feuer verwĂŒstet weitere RĂ€ume. |
| 08.10.1995 |
Wegen eines falsch eingestellten Ventils in einer Polystyrolfabrik des BASF-Konzerns entweichen rund zwei Tonnen des gesundheitsschĂ€dlichen WĂ€rmetrĂ€geröls Diphyl. Den rund 18.000 Bewohnern des Stadtteils Friesenheim wird empfohlen, kein Obst und GemĂŒse aus diesem Gebiet zu essen. Die Bevölkerung wird auĂerdem aufgefordert, TĂŒren und Fenster zu schlieĂen. |
| 16.01.1996 |
Bei der Explosion eines LagerbehĂ€lters werden vier Tanks so schwer beschĂ€digt, daĂ sie leckschlagen. Rund 3,3 Tonnen verschiedener Chemikalien gelangen ĂŒber das firmeneigene Kanalsystem in den Rhein. Drei Feuerwehrleute werden bei Rettungsarbeiten verletzt. |
| 15.08.1996 |
51 Prozent der Kali + Salz-Beteiligungs AG wird bekannt gegeben. |
| 01.01.1997 |
Die BASF will sich zum 1. Januar von ihrem Magnetprodukte-GeschÀft trennen |
| 1997 |
Bei der BASF und bei der kanadischen Potash Corporation of Saskatchewan (PCS) geht man davon aus, daĂ Bundeswirtschaftsminister GĂŒnter Rexrodt die Ăbernahme von der BASF-Tochter Kali+Salz (K+S) durch die Kanadier mit einer Sondererlaubnis genehmigt. |
| 01.01.1997 |
Die BASF trennt sich von ihrem gesamten Magnetprodukte-GeschÀft. |
| 1997 |
GrĂŒndung der "BASF-Drucksysteme" |
| 1997 |
Herbol wird Teil der neu gegrĂŒndeten "Deco GmbH" |
| 11.06.1997 |
Beim Entleeren eines Kesselwagens treten aus einer undichten Flanschverbindung zwanzig Liter der Chemikalie Acetaldehyd aus. Durch die stechenden DĂ€mpfe erleiden zwei Arbeiter Schleimhautreizungen. |
| 01.10.1997 bis 31.12.1997 |
Im 3. Quartal 1997 soll das Kraftwerk SĂŒd der BASF fertiggestellt sein. Es wird von ABB im Auftrag der RWE gebaut. Die RWE werden das Kraftwerk auch betreiben. Es leistet 400 MW Strom und 500 t Dampf und hat einen Wirkungsgrad von beinahe 90% und wird von der RWE Energie AG finanziert, geplant, gebaut und betrieben. |
| 01.11.1997 bis 31.12.1997 |
Nach Ansicht von BASF-Vorstandsmitglied Gerhard Wolf haben K+S und damit vor allem die geplanten 7 500 ArbeitsplĂ€tze auf Dauer nur unter dem Dach von PCS eine Ăberlebenschance. |
| 31.07.1998 |
In einem der beiden Staemcracker - einer Anlage zur Aufspaltung von Rohbenzin - bricht bei Reparaturarbeiten ein Brand aus. Vier Menschen werden verletzt. Der Sachschaden betrÀgt zehn Millionen Mark |
| 10.08.1998 |
Bei einer Explosion im Keller einer Styroporfabrik sterben zwei Mitarbeiter, als es aus zunÀchst ungeklÀrter Ursache zu einer Explosion kommt. |
| 1999 |
AuĂerbetriebnahme des Kraftwerks Mitte zwischen den Werken Ludwigshafen und Oppau. |
| 1999 |
Das europĂ€ische GeschĂ€ft der BASF mit Bautenfarben und -lacken wird von Akzo Nobel ĂŒbernommen. |
| 02.09.2003 |
Ein technischer Defekt an einer Filterpresse löst einen GroĂbrand in einem viergeschossigen ProduktionsgebĂ€ude A 417 im Werksteil SĂŒd aus. Dabei verbrennen 2 t Indanthren und 3000 l Methanol, und die beiden oberen Geschosse werden völlig zerstört. Dort wurden Textilfarbstoffe hergestellt. |
| 29.09.2003 |
Erster Spatenstich zum Bau eines zweiten Gas- und Dampfturbinenkraftwerks mit 240 Millionen Euro Investitionsvolumen. Es wird einen Wirkungsgrad von 40 Prozent haben und 440 MW Strom und 650 t Dampf erzeugen und soll bis Sommer 2005 fertig sein |
| 2004 |
Das GeschĂ€ftsjahr 2004 verlĂ€uft sehr zufriedenstellend: Der Umsatz wird um 13 Prozent auf 37,5 Mrd. Euro (davon in Deutschland: 7.382 Mrd.) gesteigert, wobei allerdings Preiserhöhungen mit im Spiel sind. Das Betriebsergebnis steigt um 64 Prozent aunf 4,9 Mrd. Euro. Der Kurs der Aktien steigt um 23 Prozent (Ergebnis je Aktie: 3,43 Euro und Dividende 1,70 Euro). - Seit 1990 sind allerdings ĂŒber 20.000 Stellen weggefallen, und weitere Einsparungen sind vorgesehen. Auch die GeschĂ€ftszahlen fĂŒr Januar und Februar 2005 stimmen zuversichtlich. |
| 09.03.2004 |
Das Unternehmen gibt bekannt, daà auf dem WerksgelÀnde ein neues 300-MW-Kraftwerk gebaut werde. Das mit russischem Erdgas betriebene Kombi-Kraftwerk mit Gas- und Dampfturbinen liefert ab 1997 Strom |
| 16.03.2004 |
Am Tag der Bilanzpressekonferenz wird bei der BASF "umgeflaggt". Von diesem Datum an soll weltweit das neue Logo "BASF" mit zwei vorgestellten Quadraten und dem Untertitel "The Chemical Company" eingefĂŒhrt werden. SpĂ€testens Ende 2005 soll dieser ProzeĂ abgeschlossen sein. Logodesigner ist die weltweit aktive Firma Interbrand in ZĂŒrich |
| 16.03.2004 |
EinfĂŒhrung eines neuen Firmenzeichens: Weiterhin der fette, engstehende, serifenlose Schriftzug "BASF", aber links davor ein grauer, quadratischer Rahmen und ein kleines (in den Rahmen passen wĂŒrdendes) Quadrat; unter dem gesamten Zeichen "The Chemical Company" |
| 10.2004 |
Die BASF verkauft ihr GeschĂ€ft mit Druckfarben und Druckplatten an einen Kapitalfonds, das Private-Equity-Unternehmen CVC Capital Partners. Der Kaufpreis wird offiziell nicht genannt, in Branchenkreisen ist von 600 bis 700 Millionen Euro die Rede. In der Sparte Drucksysteme beschĂ€ftigt die BASF weltweit 2.600 Mitarbeiter, davon ĂŒber 2.000 in Europa. Die GeschĂ€ftssprarte umfaĂt 16 Gesellschaften in Europa, USA, SĂŒdamerika und Asien mit 20 Standorten. In Deutschland bestehen Betriebe in Stuttgart, WillstĂ€tt und St. Ingbert |
| 11.11.2004 |
Der Umsatz steigt vom Juli bis September 2004 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahrszeitraum um 20 Prozent auf 9,3 Mrd. Euro - den besten Wert fĂŒr ein drittes Quartal in der Firmengeschichte. Das Betriebsergebnis vor SondereinflĂŒssen steigt um ĂŒber 160 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro. In den ersten neun Monaten wurde bereits mehr Geld verdient als im Gesamtjahr 2003. Sieht man von Problemen mit der Feinchemie ab, dann hat der Konzern keine wesentlichen Schwachstellen. Seit Jahresanfang ist die Nettoverschuldung um 34 Prozent auf 1,9 Mrtd. Euro gesenkt worden. |
| 23.11.2004 |
Pressekonferenz: Die BASF bekennt sich zu ihrem gröĂten Standort, investiert in den nĂ€chsten Jahren hoch in Ludwigshafen, baut aber dort weiter Personal ab: von 35.600 (September 2004) auf vsl. 32.000 (2007); das ergibt sich aus einer Betriebsvereinbarung, die im Rahmen der Pressekonferenz unterzeichnet wird. Von den abzubauenden 3.600 ArbeitsplĂ€tzen sollen rd. 700 Aniliner in die BASF-eigene Job-Agentur ĂŒberwechseln; von den restlichen Stellen sei etwa die HĂ€lfte bereits ĂŒber VertrĂ€ge geregelt. Die Vereinbarung sieht weiter vor, daĂ es bis Ende 2010 keine betriebsbedingten KĂŒndigungen geben wird. |
| 28.04.2005 |
BASF bietet seinen AktionÀren gute Quartalszahlen: Der Umsatz legt um 11 Prozent auf 10,1 Mrd. Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern schnellt um gut 39 Prozent auf 1,49 Mrd. Euro empor. Dennoch wird der kontinuierliche Personalabbau fortgesetzt. |
| 01.03.2006 |
Steigerung des Umsatzes um 24 Prozent auf 12,5 Mrd. Euro im ersten Quartal. Das Ergebnis der BetriebstĂ€tigkeit legt um 19 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro zu. Die UmsatzzuwĂ€chse basierten zuvor ĂŒberwiegend auf höheren Preisen - nur konnte man auch die verkaufte Menge deutlich steigern. |
| 23.03.2006 |
Die vor fĂŒnf Jahren gegrĂŒndete IT-Tochter der BASF "IT Services" (Jahresumsatz: 364 Mio Euro) verlagert ihre Holding von den Niederlanden und der Schweiz zurĂŒck nach Ludwigshafen. (Meldung vom 23.03.) |
| 2007 |
Das Unternehmen kauft im Verlaufe des Jahres eigene Aktien im Werte von 1,9 Milliarden Euro zurĂŒck. FĂŒr die rund 21,5 Millionen Papiere wird ein Preis von durchschnittlich 88,35 Euro bezahlt. Die zurĂŒckgekauften Aktien entsprechen 4,3 Prozent des Grundkapitals der BASF. Das insgesamt 3 Milliarden Euro schwere RĂŒckkaufprogramm wrid bis Ende 2008 fortgesetzt. |
| 26.04.2007 |
Konzernchef JĂŒrgen Hambrecht prĂ€sentiert die Zahlen fĂŒr das 1. Quartal des GeschĂ€ftsjahres. Das Unternehmen zeige sich in Best-Form (Klammerwerte 1. Quartal 2006): Umsatz 14.632 (12.515) Mio Euro, Ergebnis der BetriebstĂ€tigkeit 2.010 (1.849) Mio Euro, Ergebnis vor Ertragssteuern 1.916 (1.870) Mio Euro, Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter 1.035 (950) Mio Euro, Ergebnis je Aktie 2,08 (1,87) Euro, Cashflow aus laufender GeschĂ€ftstĂ€tigkeit 701 (1.448) Mio Euro, Investitionen 439 (600) Mio Euro, Abschreibungen 663 (552) Mio Euro, Personalaufwand 1.595 (1.392) Mio Euro |
| 22.02.2008 |
Vorlage der Bilanz 2007 durch BASF-Chef JĂŒrgen Hambrecht. Er will trotz hoher Rohstoffkosten und DollarschwĂ€che neue Bestmarken setzen. Dazu will er den Druck erhöhen, was auch die Mitarbeiter durch Steigerung der Effizienz und konsequente Kostenreduzierung betrifft. Die Konzerntochter Wintershall steuerte rd. 3 Mrd. Euro zum Gewinn bei, das sind gut 200 Millionen weniger als im Vorjahr. Bilanzzahlen fĂŒr 2007 (in Klammern: 2006) in Millionen Euro: Umsatz 57.951 (52.610), EBIT 7.316 (6.750), Ergebnis vor Steuern 6.935 (6.527), Ergebnis nach Steuern 4.065 (3.215), Cashfolw 5.807 (5.940), Investitionen 4.425 (10.039), Abschreibungen 2.909 (2.973), Personalaufwand 6.648 (6.210), Ergebnis je Aktie 8,32 (6,37) Euro |
| 15.09.2008 |
Die BASF ĂŒbernimmt den Schweizer Konkurrenten "Ciba SpezialitĂ€tenchemie AG" in Basel. Wie beide Unternehmen berichten, hat die BASF fĂŒr alle Ciba-Aktien 3,8 Milirarden Euro oder 6,1 Mrd. Franken geboten. Davon entfallen 3,4 Mrd. Franken auf die Barofferte der BASF, der ĂŒbrige Teil betrifft die SchuldenĂŒbernahme. Das Angebort entspricht einem Aufpreis auf den Ciba-SchluĂkurs von 32 Prozent und sogar von 64 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Handelstage. Die Veröffentlichung fĂŒrht zu heftigen Kursreaktionen: WĂ€hrend der Ciba-Aktienkurs um mehr aks 37 Prozent hochschnellt, sinkt der BASF-Kurs um mehr als 5 Prozent. |
| 2. Quartal 2012 |
In zweiten Quartal sinkt der Gewinn um knapp 16 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro. Dennoch soll das Jahr 2012 ein neues Rekordjahr werden. |